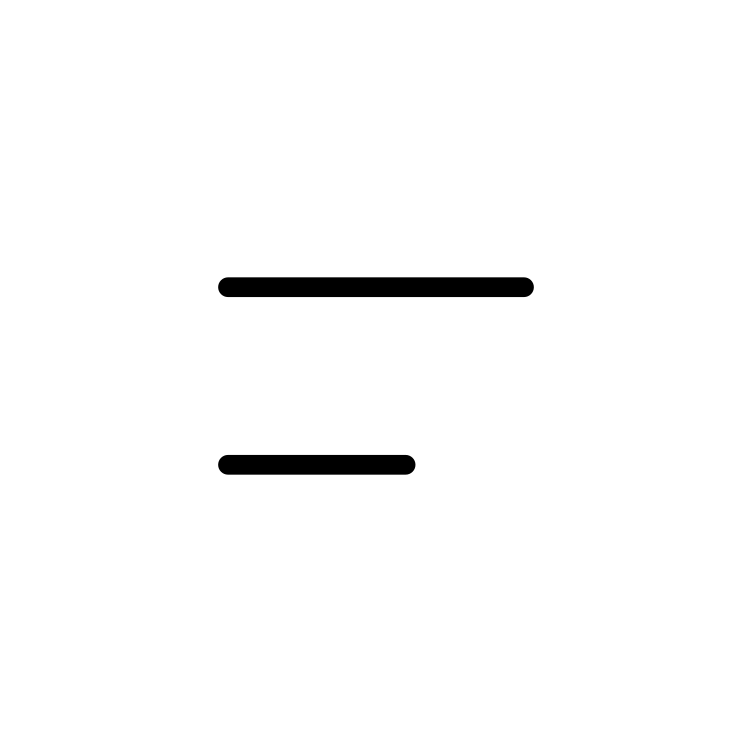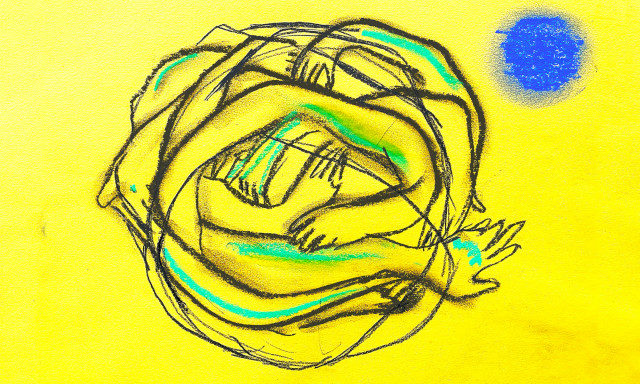
Nachdenken über Design
Haben wir uns in einem Missverständnis verfangen?
Ein kurzer Abriss der Formgeschichte des Mähroboters: Der erste vollautomatisierte Mähroboter kam aus Schweden und wurde 1994 für 5.500 DM von der Firma Husqvarna auf dem europäischen Markt angeboten. Mit flachem ovalen Solar-Panel und kaum sichtbarem Antrieb sah der Roboter wie ein Insekt aus und mähte nach dem Prinzip “wenig schneiden, dafür aber öfter” unauffällig über Wiesen. Ein Prinzip, das von der Natur und dem grasenden Tier auf der Weide abgeschaut wurde und ein hoffnungsvolles Konzept für den Einklang von Technologie und Natur. Laut Hersteller sei dieses Prinzip bis heute in der Formsprache wiederzufinden.
In den frühen und späten 2000er-Jahren entwickelte sich die Formsprache des Mähroboters mit wachsender Expansion in Richtung Haushaltsroboter. Der Mähroboter wurde Teil der Haushaltsgerätefamilie. Und das sah man ihm auch an. Der Robomow RT700 sah zum Beispiel so niedlich aus, als hätte ihn die Familie am Frühstückstisch entworfen.
Mitte der 2010er Jahre kam der Schwenk. Mittlerweile sind die Gartenroboter in allen Weltteilen angekommen und für Grünflächen aller Größen spezialisiert. Weltunternehmen, wie Bosch und Honda, stiegen ins Geschäft ein. Und es ist schwer, die Konvergenz der Branchen nicht auch in der Designsprache zu beobachten: tiefsitzende Augen, dynamisches Heck, schützende Panzerung und eine Front, die im Weg stehendes Wild einfach wegschaufeln könnte. Design-Darwinismus. Der Erfolg des Transportation Designs ist nun auch im Haushaltsrobotersegment angekommen. Und mit ihm scheinbar auch ein Erfolgskonzept aus dem Transportation Design – das SUV.
Erfolgskonzepte sind ansteckend.
Der Marktanteil der SUVs liegt in Deutschland bei knapp 29 Prozent (KBA Zulassungen 2022) und löst damit einige hochaktuelle Absatzprobleme der Automobilindustrie. Fast jedes dritte neue zugelassene Auto auf deutschen Straßen ist ein „straßengängiger Geländewagen“ oder „geländegängiger Straßenwagen“. Dabei ist der SUV kein geländetaugliches Spezialprodukt, das sich in die Stadt verirrte. Er ist für die Stadt und die Schnellstraße gebaut. Und sein Erfolgskonzept scheint ansteckend zu sein. So wurden mittels Achsenverbreitung, Karosserieerhöhung, Erweiterung des Fahrgastinnenraums und einem deutlich höheren Materialverbrauch aus ikonischen Stadt- und Familienfahrzeugen der frühen 2000er plötzlich Familienbunker. Beispiele: Toyota Crown, Fiat 500 4x4 oder Smart #1 usw. Der SUV verspricht die romantische Idee des Geländewagens, mit dem Wüsten erobert, Sümpfe durchpflügt, Furten durchwatet, Dschungel durchquert und – nicht zuletzt – Kriege geführt werden können. Der bekannteste Vorfahre der SUV, der Jeep, ist militärischen Ursprungs und kein ländliches Nutzfahrzeug. Er wurde gebaut um Überleben in lebensfeindlichen Umgebungen zu sichern.
SUV = Sicherheit? Haben wir Konsens mit einem Missverständnis geschlossen?
Eine derzeit gängige These besagt, dass die Nutzung eines SUV in Städten ikonografisch der Aufkündigung gesellschaftlicher Solidarität entspräche. Also Kampf und Revolution. Hinsichtlich Material-, Kraftstoff und Platzverbrauch lassen sich hier einige nachvollziehbare Argumente für diese These finden. Eine weniger reißerische These besagt, dass der SUV die Rückbesinnung zum Zugang zur Natur ist. Paradox, aber nicht unwahrscheinlich – denn die Sehnsucht nach dem Ländlichen und der Wunsch nach Rückzug lassen uns zu Mitteln und Werkzeugen greifen, die naheliegend sind. Schnupfen = Tempo. Sicherheit = SUV. Und da hilft auch kein SUV-Bashing wenn im kollektiven Bewusstsein das Ländliche und das Überleben darin mit dem Geländewagen einhergeht. Vermutlich nicht das erste Mal, dass Konsens mit einem Missverständnis geschlossen wurde.
Aus Wünschen werden Normen. Warum macht das Design hier eigentlich mit?
Aus Wünschen und Möglichkeiten werden Normen und Erwartungen. Wo Leistungsfähigkeit nahezu angeglichen ist (was im Mobilitätsmarkt der Fall ist), da macht Design noch den Unterschied. Design ist hierbei einer der mächtigsten Hebel. Und wo Probleme sich nicht lösen lassen, wie z. B. das paradoxe Bedürfnis nach einem sauberen Planeten und gleichzeitig nach einem privaten Geländefahrzeug, dort wird das Design für eine Lösung befragt. Als Konsequenz führt das dazu, dass Designer:innen in einer ständigen paradoxen Konstellation zwischen Skalierbarkeit, Individualisierung und Verantwortung agieren.
Individualität von der Stange.
Designer entwerfen Massenprodukte, die gleichzeitig zur individuellen Identitätsstiftung beitragen.
Komfortable Revolution.
Designer:innen sind meistens damit beschäftigt schrittweise Veränderungen und offensichtliche Widersprüche so komfortabel wie möglich für Ihre Nutzer:innen zu verpacken um diese bei der Stange zu halten.
Ästhetische Ethik.
Dinge sollen nicht nur schön, sondern auch gut sein (sagt auch A. Reckwitz). Das heißt, Design hat einen Anspruch daran optische Gefälligkeit und gleichzeitig gesellschaftlichen Nutzen zu erfüllen. Manchmal wäre es vielleicht sogar sinnvoll gar nichts zu tun.
Unterm Strich ist Design heute die Generalsdisziplin für Gestaltungsfragen, die neben Kriterien wie Klimaneutralität, ethisch vertretbarer Beziehungen zu Lieferanten und Umwelt, auch mindestens genauso die Bildung und Erhaltung von Gewohnheiten sowie Wirtschaftlichkeit zu ermöglichen hat. Das Korsett ist so eng, dass eigentlich gar keine Luft für Gestaltung bleibt.
Wozu dann überhaupt Design wenn es nichts mehr darf?
Im Jahr 1998 führte Fiat das Modell Multipla ein. Entworfen von Roberto Giolito, der auch schon die Neuauflage des Fiat 500 im Jahr 2007 verantwortete, versprach das Fahrzeug eine Antwort auf die ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Probleme des 21. Jahrhunderts zu geben: auf der Fläche eines Fiat Punto hatten bis zu 6 Personen Platz, ein 360-Grad-Rundumblick ermöglichte maximalen Blickkontakt. Die Fahrgast- und Antriebskarroserie so klug getrennt, dass sie trotz geringer Knautschzone maximale Sicherheit für alle Insassen bietet. Ein Mini-Van als Antwort auf die Frage nach der optimalen Platz-Nutzen-Balance. Eine gesellschaftliche Einladung zur Solidarisierung von Stadt, Mensch und Mobilität. Die Designsprache so harmlos und nahbar, sie erinnert an Kermit den Frosch. Und der Aufschlag von Fiat so radikal, dass das M.O.M.A. ein Exemplar in ihre Designsammlung aufnahm.
Nun war der Multipla aber auch so erfolglos, dass sich Fiat nach knapp 10 Jahren Shortlist-Anführerschaft jedes Designunfall-Rankings entschied, den Multipla vom Markt zu nehmen. Der Multipla kam schlichtweg nicht beim Publikum der damaligen Gegenwart an. Das Design von Chefdesigner Roberto Giolito wurde verspottet. Aufrechter Sitz und Funktionalität, weniger Dolce Vita, dafür aber auch weniger Materialeinsatz. Ein Flopp. Mit der Neuauflage des Fiat 500 im Jahr 2007 schienen sämtliche Solidarisierungsversuche wieder passé zu sein, und Fiat wieder vermehrt auf Dolce Vita als urbanes Mobilitätsmodell setzend, platzierte mit einer Retro-Wiederauflage einen Publikumshit (der mit dem Fiat500 4x4 heute auch eine SUV-Variante für die Stadt stellt).
Ist Design so machtlos? Kann eine so tiefgreifende Modellentscheidung ausschließlich durch Verkaufszahlen validiert werden? Ist Timing alles? Welchen Auftrag hat Design überhaupt, wenn es nicht auch einen Nudging-Effekt hat? Der Raum ist offen für neuen Designanspruch.
Was müsste denn passieren? Eine naive Gedankensammlung.
Erfolgskennzahlen für Design, die gesellschaftliche Wirkung verfolgen
Design ist immer auch politisch. Designer:innen treffen mit jeder Gestaltungsentscheidung auch indirekt politische Entscheidungen. Was Absatzziele als Credo für Erfolg setzt, sollte zunehmend auch gesellschaftliche Wirkung mit einbeziehen. Dafür braucht es neben neuen ökonomischen „Erfolgsparametern“ (siehe Wirtschaftsjahresbericht 2022) auch Parameter, die positive Veränderungen von Gewohnheiten darstellen (z. B. Anzahl Fahrzeug pro Kopf, Anteil Individualverkehr ggü. ÖPNV, etc.).
Designer:innen als Aktivist:innen und Kritiker:innen, nicht als Dienstleister:innen
Design ist reflektierend und sollte das Ziel verfolgen, den Status Quo in Frage zu stellen. Design hat immer ein selbstbezogenes Interesse an den Problemen anderer. In der Geschichte des Designs als Träger aufklärerischer und universalistischer Ideale ist Design auch immer eine wohlwollend paternalistische Praxis gewesen. Und das Selbstverständnis der Designer:innen, Architekt:innen und Planer:innen hat einen Blick auf andere kultiviert, denen Gutes angetan werden soll. Dafür sind Designer:innen stärker denn je gefragt, eine Haltung und Veränderungswillen dort einzufordern, wo Entscheidungen zum Wohl der einzelnen Person soziale und ökologische Konsequenzen hat. (Punkt 1 könnte zum Beispiel auch dabei helfen im skalenorientierten Unternehmenskontext mehr Durchschlag hinter Designentscheidungen zu setzen.)
Lösungsansätze in den Extrempunkten der Gesellschaft suchen, nicht nur in der Mitte
Ohne Designalternativen gibt es keinen Designdiskurs. Diskurs kann nur dann gedeihen, wenn die Masse der normalen Bürger wirklich die Gelegenheit hat, sich durch echte Alternativen am Markt daran zu beteiligen. Wir entwerfen besseres Design wenn wir uns über die Extrempunkte einer Gesellschaft an Fragestellungen nähern, anstelle einer durchschnittlichen grauen Masse zu entsprechen. Dafür muss sich Design auch in den Extremen verorten und sichtliche Gegenentwürfe zu einem Mainstream bieten. Um Claudia Banz wiederzugeben, sind Produkte auch immer Abbild unserer Gesellschaft und vice versa.
Veränderung braucht Zeit
Umdenken braucht Zeit. Und radikale Veränderungen brauchen vermutlich mehr als ein Jahrzehnt um im gesellschaftlichen Konsens anzukommen. Wir haben ca. 3 Jahre gebraucht um zu verstehen, dass ein Smartphone ohne Tastatur sinnvoller ist weil der Vorteil eines größeren Displays sichtlich überwiegt bevor Tastaturmobilitelefone in der Nische verschwanden. Wie lange werden wir brauchen um zu lernen, dass eine vermeintliche Komforteinschränkung zu akzeptieren sinnvoll ist, weil der ökologische Vorteil absolut überwiegt? Vermutlich länger als zwei Produktentwicklungszyklen (ca. 10 Jahre).
Aus Haltung Normen machen. Nicht aus Bedürfnissen.
Ich wünsche mir ein Design, das echte Kundenprobleme löst, statt diese schönzureden. Weil gutes Design klüger ist als seine Nutzer und echte Erziehungsarbeit an der wichtigsten Schnittstelle unserer Außenwelt gestaltet: Nicht die Usability und Gefälligkeit der Bedienung, sondern an Werten, Normen und Routinen. Indem Design Vielfalt in der Zivilisation fördert, indem es Vielfalt abbildet und zugänglich macht. Indem Design wieder einen Auftrag hat, durch Gesellschaftsschichten zu wirken, statt sich auf eine liquide Käufermitte zu fokussieren. Menschen sind wie Dinge auch ein Produkt sozialer Diskurse und Praktiken ihrer jeweiligen Zeit. Und so, wie wir Dinge schaffen, werden diese auch uns machen und beeinflussen. Wenn der positive gesellschaftliche Nutzen also mindestens gleichauf der Verkaufzahlen zum Erfolg eines Produktes beiträgt, wäre der Knoten doch erstmal gelockert, oder?
2. Januar 2023 (AW)